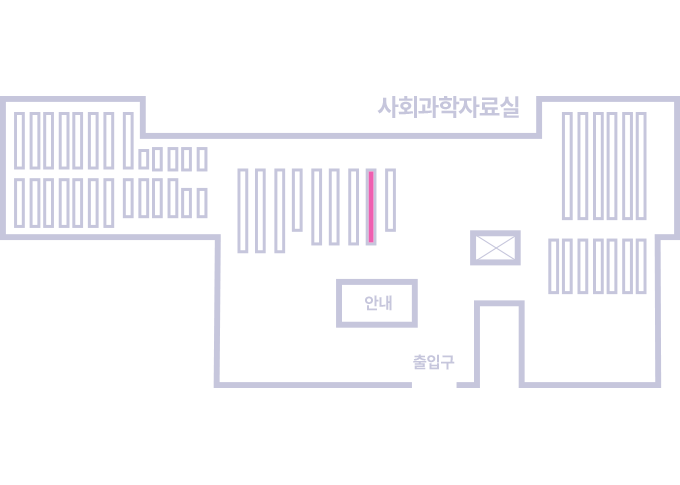Auch Kunstliche Intelligenz ist Trager von Grundrechten. Interdisziplinar fundiert begrundet der Autor dieses Ergebnis rechtstheoretisch und rechtsdogmatisch. Die Arbeit modelliert die Grundrechtsberechtigung hinsichtlich verschiedener Grundrechte umfassend und untersucht auch die Bedeutung der These in der konkreten Rechtsanwendung und im Zivilrecht. Das Ergebnis der ≫partiellen Grundrechtsfahigkeit≪ kunstlicher Intelligenz steht auch der Regulierung nicht entgegen.
≫Fundamental Rights of Artificial Intelligences≪: Artificial Intelligence (AI) is partially entitled to fundamental rights. This counterintuitive result is the central hypothesis of the exploration, which is supported by an interdisciplinary, theoretical and dogmatic framework. However, the position of AI is not comparable to those of humans. The author develops a model to show in which circumstances AI is entitled to fundamental rights under the Grundgesetz. This model may also serve as a basis for the regulation of AI.
Kunstliche Intelligenz (KI) ist in bestimmten Kommunikationsverhaltnissen Trager von Grundrechten. Dieses Ergebnis lasst sich unter Heranziehung der postmodernen Rechtstheorie, aber auch aus dem gesicherten dogmatischen Besitzstand der Grundrechte begrunden. Zahlreiche Grundrechte schutzen nicht ausschließlich den Trager als solchen, sondern als ≫inpersonale Rechte≪ einen kollektiven Prozess der Grundrechtsausubung, etwa den ≫Kampf der Meinungen≪, und damit auch Dritte. Interdisziplinar und ebenso in der Dogmatik einzelner Grundrechte ist anerkannt, dass die Handlungen bzw. Kommunikation von KI sich der Zurechnung zu Menschen entziehen. Diese Zurechnungslucke ist zu schließen, indem das Recht die Relevanz kunstlicher Kommunikation durch die Grundrechtsberechtigung von KI anerkennt. Der Autor schlagt eine ≫partielle≪ Grundrechtsfahigkeit vor, abgestuft nach Kommunikationsverhaltnis und jeweiligen Eigenheiten des betroffenen Grundrechts, die auch der Regulierung nicht entgegensteht.
About the Author
Dissertationsschrift